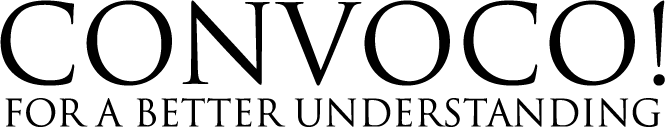BLOGEuropa hat vieles zu bieten – kulturelle Vielfalt, offene Grenzen, starke Wissenschaft. Doch zwischen Ideenreichtum und wirtschaftlicher Umsetzung klafft oft eine Lücke. Wie kann Europa zum echten Innovationsmotor werden? Der Beitrag beleuchtet Herausforderungen wie Bürokratie, Kapitalmangel und Mentalitätsfragen – und fragt, wo Chancen für einen echten Aufbruch liegen.

Europa hat Kulturvielfalt, Demokratie, offene Grenzen, eine einheitliche Währung, also viele Standortvorteile. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass wir es bislang nicht ausreichend
schaffen, Größe und technologisch-wirtschaftliche Bedeutung durch die Bündelung unserer Kräfte zu nutzen.
René Obermann
Co-Head Europa von Warburg Pincus, Geschäftsführer der Warburg Pincus Deutschland GmbH

Any of the best talents in Europe will go to America or elsewhere, where they can grow their business with fewer obstructions and limitations inherent to Europe. Europe has 27 languages, disparate populations,
a challenging geography, and the wealth is decentralized. Just that makes it harder to innovate as a baseline. This is the exact opposite of what is needed.
Bruce Pon
Founder and Board Member at Ocean Protocol

Der Innovationsstandort Deutschland ist hervorragend. Wir haben hier sogar mehr Nobelpreisträger pro Kopf als in den Vereinigten Staaten und liegen nur hinter Skandinavien, England und der Schweiz. Das heißt, die Innovation, die Förderung von Innovation,
insbesondere von öffentlicher Hand, ist hervorragend. Unser Problem ist die Übersetzung dieser Innovation in unternehmerisches Handeln und unternehmerische Veränderung der Gesellschaft und auch des Wirtschaftsstandorts.
Peer M. Schatz
International tätiger Biotech-Manager und langjähriger CEO des Diagnostikunternehmens QIAGEN

Wir beobachten, dass es sog. Killzones oder auch Killer Acquisitions gibt, dass es für Startups extrem schwierig wird, Perspektiven zu entwickeln, die an den großen Digitalunternehmen vorbeilaufen, weil sie sozusagen immer fürchten müssen
– und für manche ist das auch eine willkommene Exit-Strategie –, aufgekauft zu werden. […] Eigentlich ist das nicht das wirtschaftliche Modell, das wir haben wollen.
Prof. Dr. Rupprecht Podszun
Wettbewerbsrechtsexperte und Professor für Kartellrecht an der Universität Düsseldorf
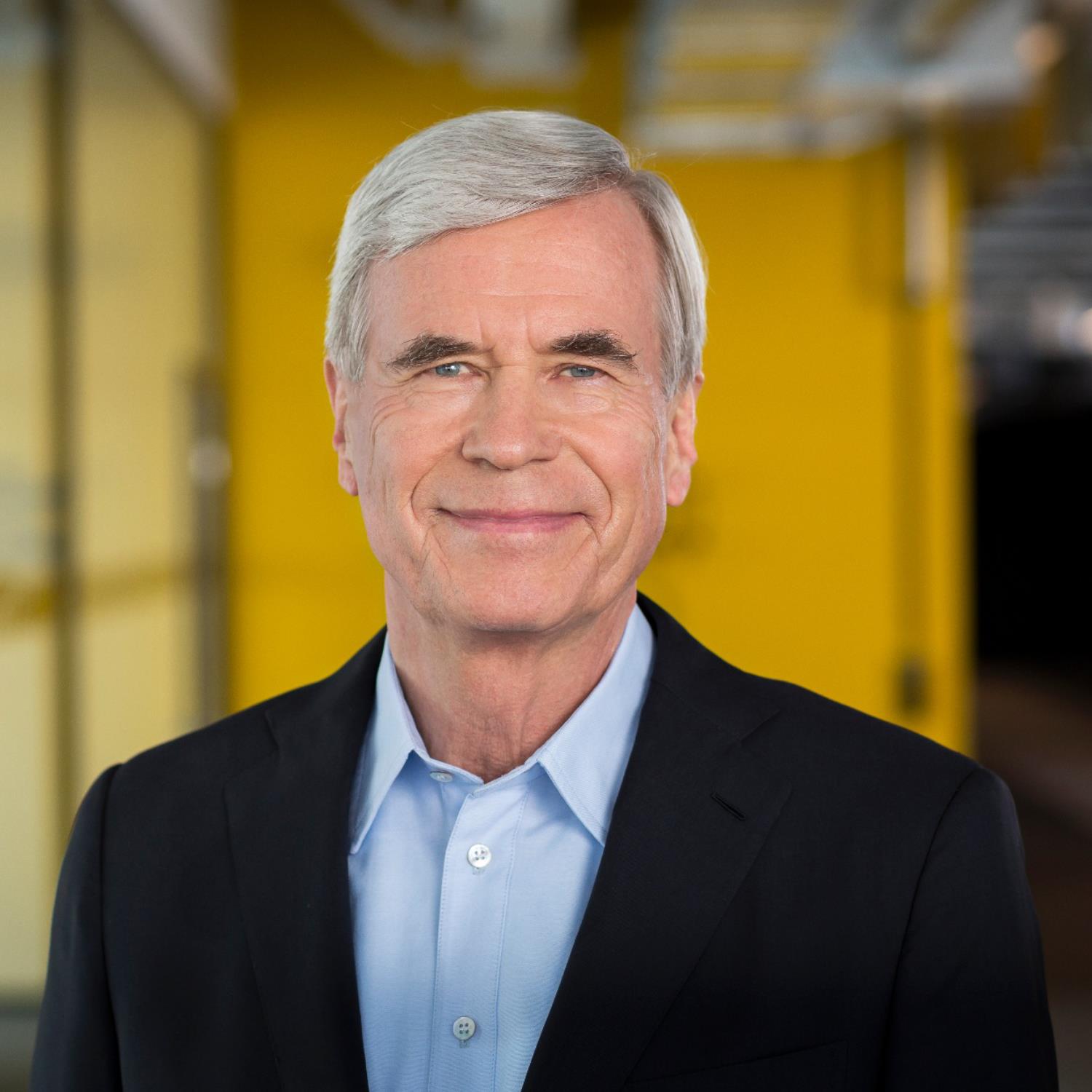
Wir beobachten, dass es sog. Killzones oder auch Killer Acquisitions gibt, dass es für Startups extrem schwierig wird, Perspektiven zu entwickeln, die an den großen Digitalunternehmen vorbeilaufen, weil sie sozusagen immer fürchten müssen
– und für manche ist das auch eine willkommene Exit-Strategie –, aufgekauft zu werden. […] Eigentlich ist das nicht das wirtschaftliche Modell, das wir haben wollen.
Dr. Michael Otto
Unternehmer und Ehrenaufsichtsratsvorsitzender der Otto Group
Globale Konkurrenz: USA, China und die Rolle Europas

The United States has a clear advantage because innovations tend to emerge from spontaneous interactions between inventors and entrepreneurs in the communities where they live.
So, it’s far from clear that China’s vast abundance of data is an advantage, and its ability to execute from the top down has an innovation advantage.
Dr. Carl B. Frey
Professor of AI

Dieser Optimismus, den man in den Vereinigten Staaten hat, führt dazu, dass man viel aggressiver und viel risikofreudiger Unternehmensgründungen macht, und man hat eine Infrastruktur, die das entsprechend unterstützt. Die Ausbildung, die Grundschulausbildung, aber auch die soziale Anerkennung von Gründern ist in den Vereinigten Staaten deutlich höher. Da werden Unternehmenspersönlichkeiten,
die selbst gegründet haben, ganz anders gefeiert als hier in Europa, wo oft Großkonzernvorstände viel prominenter sind als die eigentlichen Gründer. Das Zweite ist die Infrastruktur, die Finanzierung, die Business Angels, die Leute, die eine entsprechende Gründungserfahrung haben und diese weitergeben können an junge Technologiegründer.
Peer M. Schatz
International tätiger Biotech-Manager und langjähriger CEO des Diagnostikunternehmens QIAGEN
ReflexionWie gelingt der Weg nach vorne?
Innovation braucht Spielräume – und Vertrauen in unternehmerische Initiative. Was viele Stimmen eint: Staatliche Förderung allein reicht nicht aus. Statt zu viel zu regulieren, sollte Politik verlässliche Rahmenbedingungen schaffen, Märkte offenhalten und gezielt dort unterstützen, wo privatwirtschaftliche Lösungen an Grenzen stoßen.
Bruce Pon mahnt, dass Regierungen nicht lenken, sondern faire Regeln setzen sollten. Carl Benedikt Frey zeigt auf, wie übermäßige Regulierung – selbst gut gemeinte wie die DSGVO – vor allem kleinere Unternehmen bremst. Gleichzeitig betont er, dass Innovationskultur auch von individueller Risikobereitschaft lebt.
René Obermann und Rupprecht Podszun plädieren dafür, staatliche Investitionen klüger zu lenken: in Infrastruktur, in neue Geschäftsmodelle – nicht in überholte Branchen von gestern. Peer Schatz ruft dazu auf, erfahrene Gründer zu stärken, Innovation professionell zu begleiten und ambitionierte Gründungsziele zu setzen. Und Arend Oetker bringt es auf den Punkt: „Man muss auch mal einen Fehler machen dürfen.“
Europas Innovationskraft braucht Mut, Offenheit und weniger Bürokratie. Nur so entsteht Raum für das Neue.